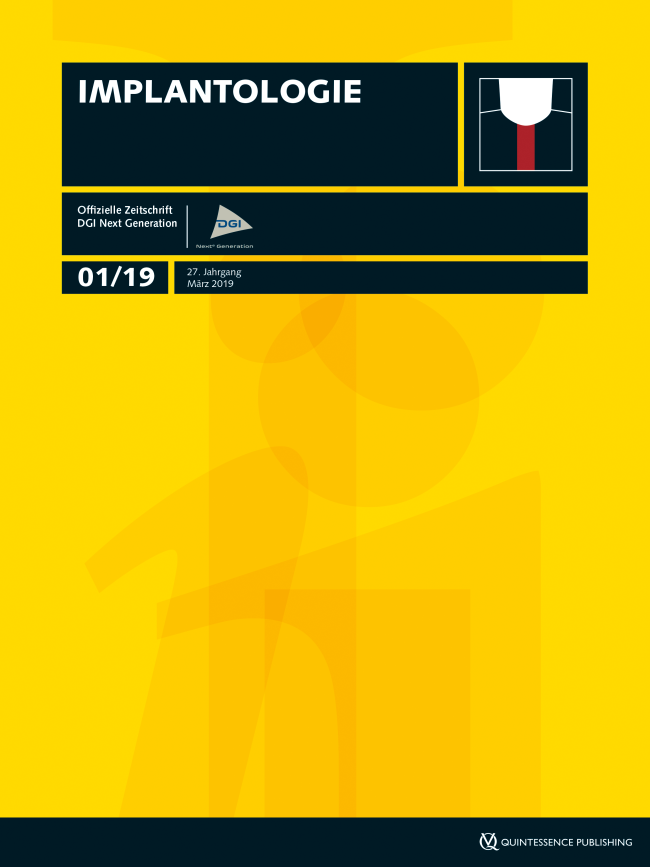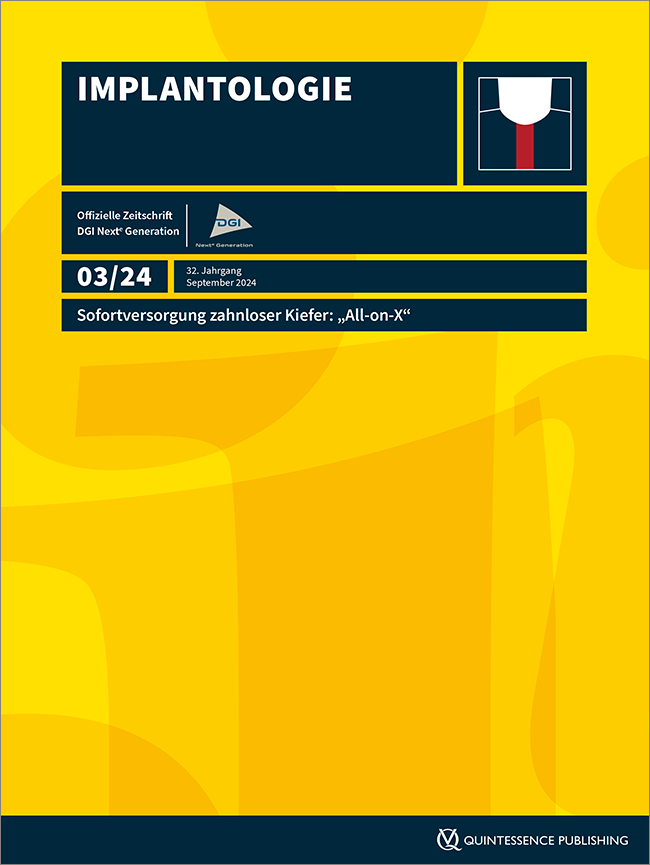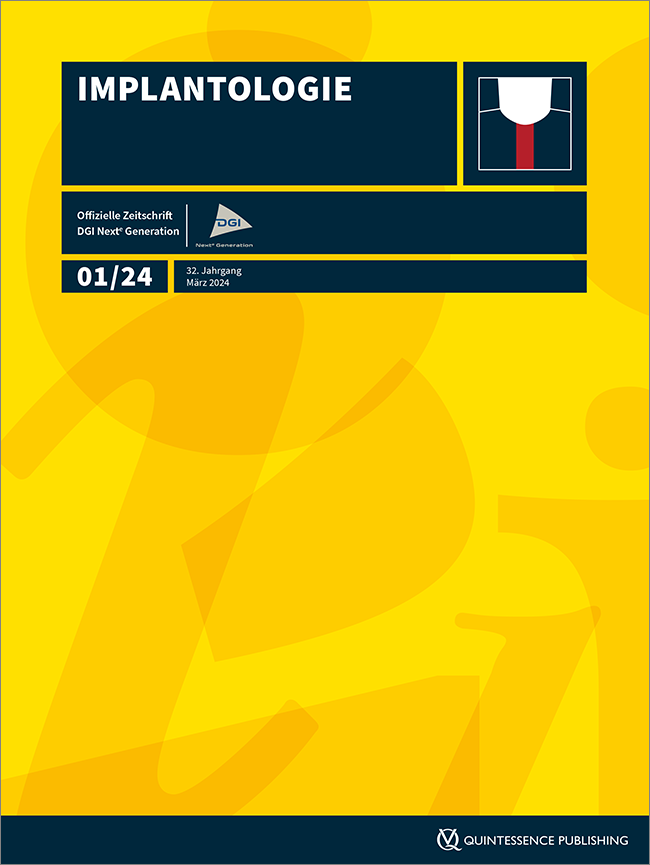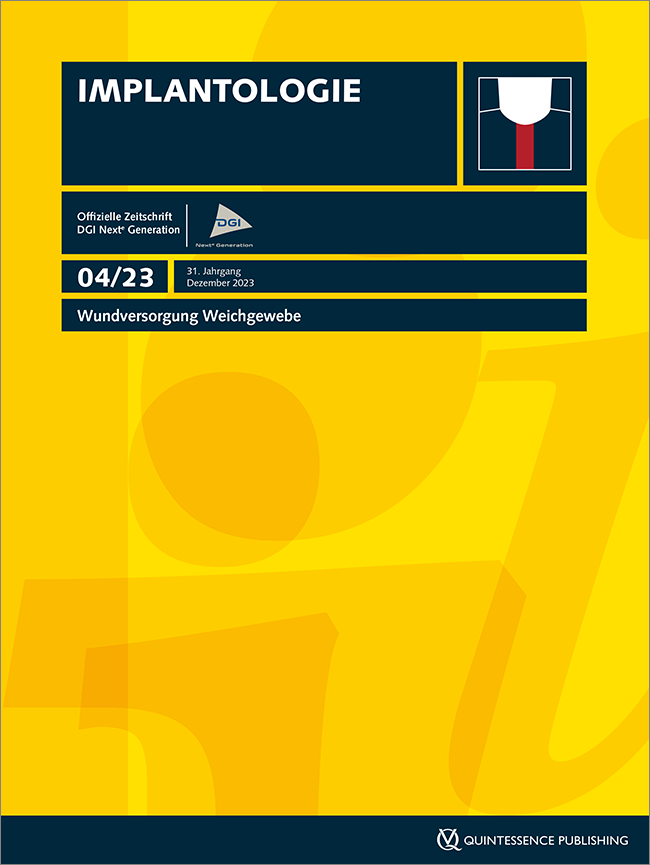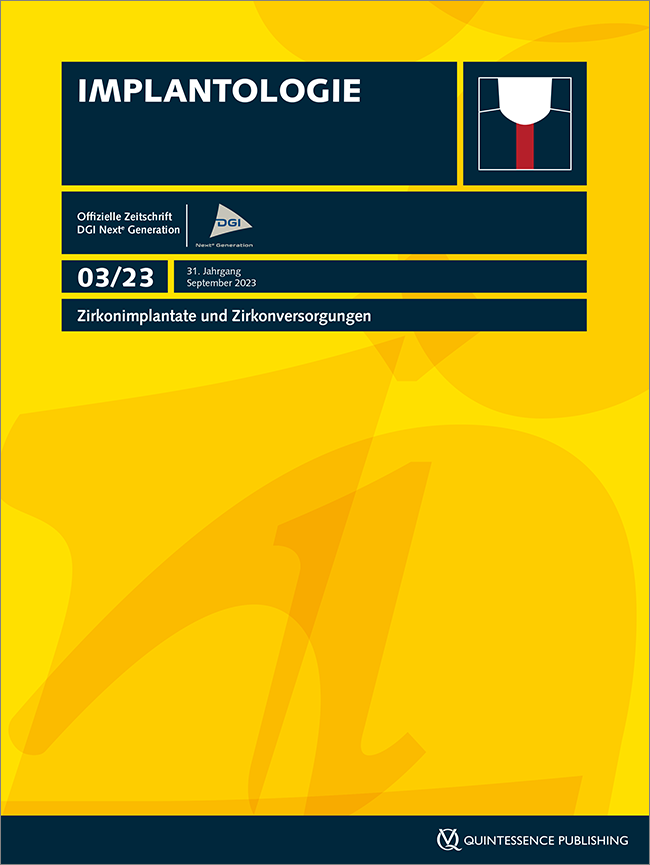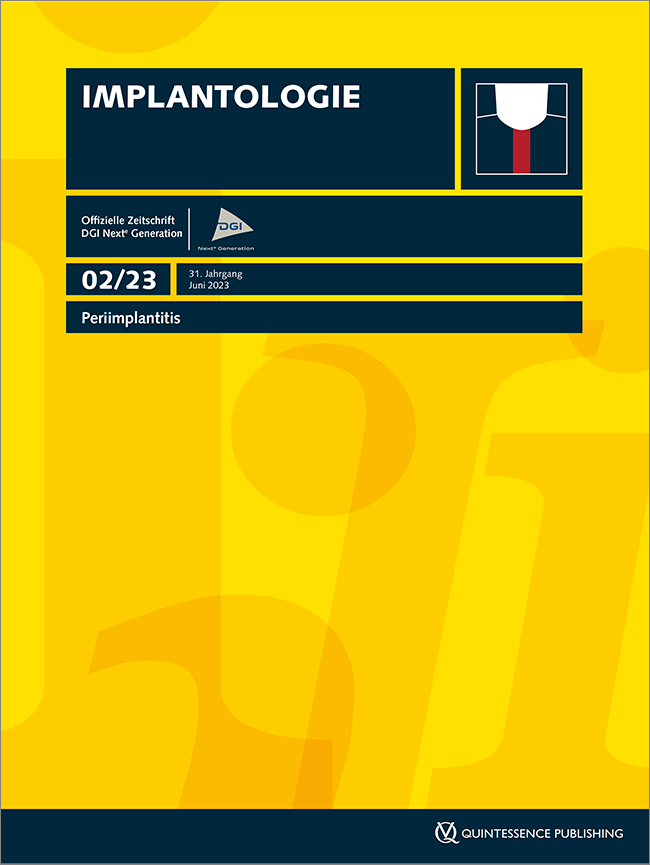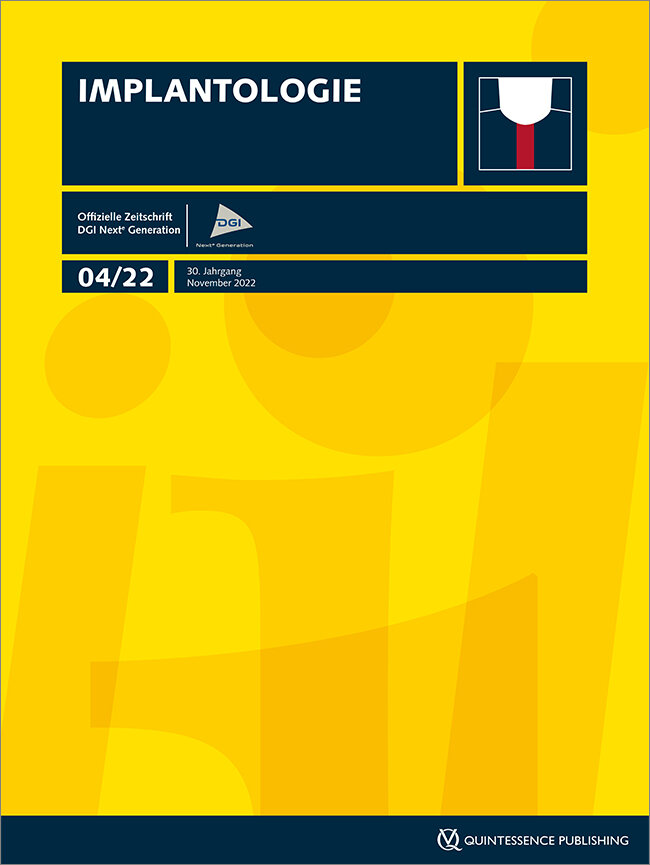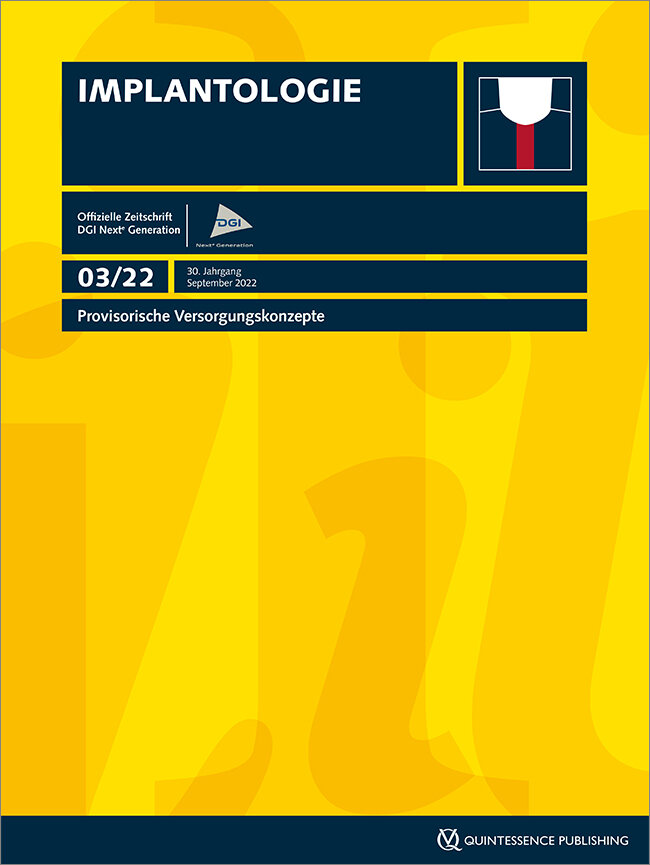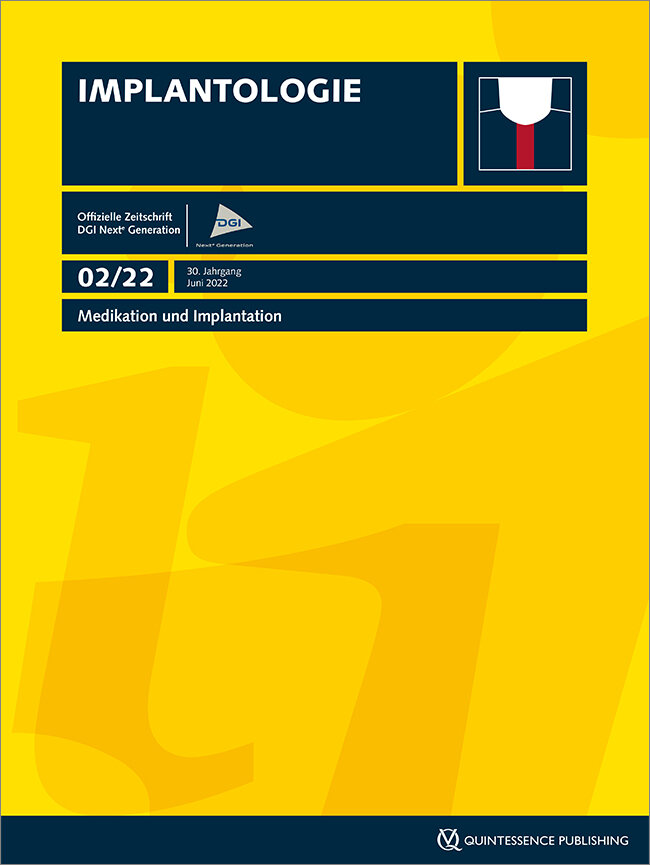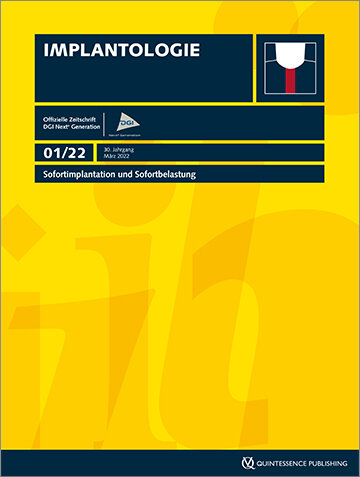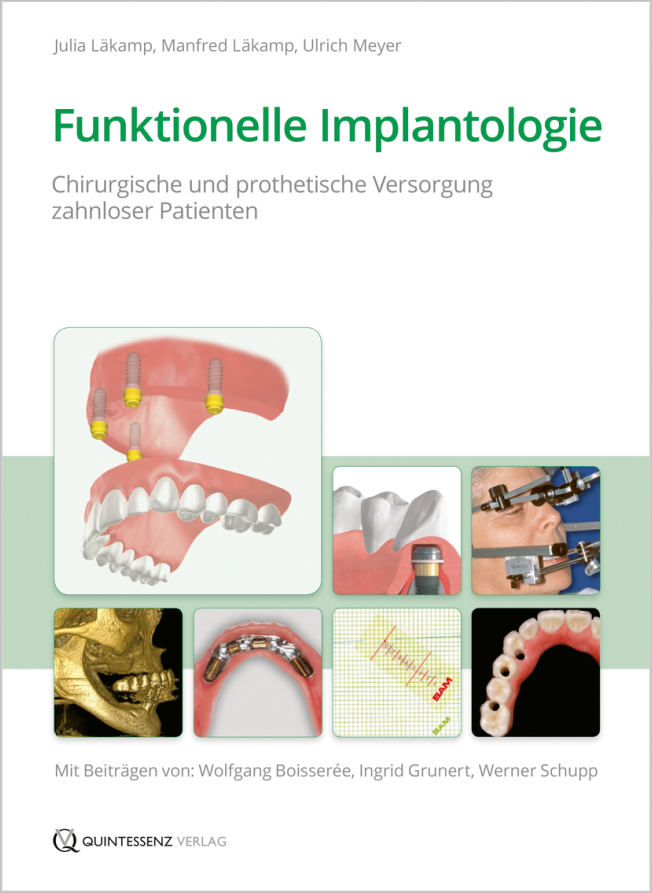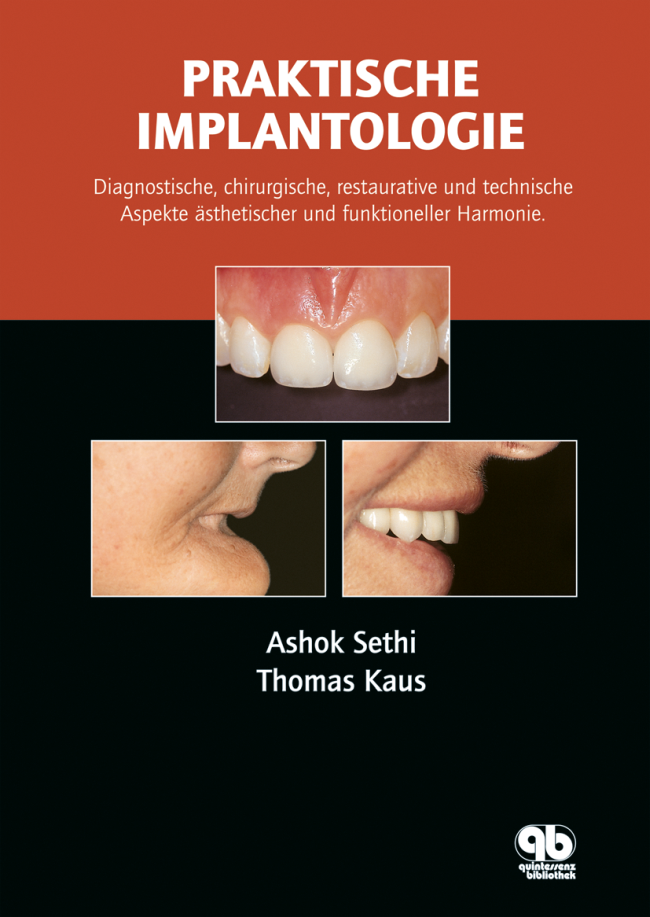Seiten: 251-252, Sprache: DeutschWeng, DietmarEditorialSeiten: 259-267, Sprache: DeutschKern, Jaana-Sophia / Wolfart, StefanAktuelle Datenlage und EmpfehlungenZu den Therapiekonzepten für den zahnlosen Kiefer zählt die festsitzende Versorgung auf vier Implantaten. Diese werden in der Regel anterior axial und posterior distal anguliert gesetzt, um ein möglichst großes Unterstützungspolygon zu erzielen und den ortständigen Knochen durch ein langes Implantat voll auszunutzen. Dieses Konzept ist, je nach Implantathersteller, zum Beispiel unter den Begriffen „All-on-4“, „Comfour“ oder „Pro-arch“ bekannt und wird in diesem Artikel unter dem neutralen Begriff „4-Implant-Konzept“ geführt. Der vorliegende Artikel befasst sich mit der genannten Versorgungsform für den Oberkiefer und gibt einen Überblick über die aktuelle wissenschaftliche Datenlage sowie die Empfehlungen aus der S3-Leitlinie „Implantatprothetische Versorgung des zahnlosen Oberkiefers“. Die zunächst nahezu ausschließlich retrospektive Studienlage wurde im Laufe der letzten Jahre um einige wenige prospektiv angelegte klinische Studien erweitert. Betrachtet man die Implantatüberlebensraten, die in diesen Studien für das 4-Implant-Konzept im zahnlosen Oberkiefer beschrieben wurden, so liegen diese für einen Untersuchungszeitraum von bis zu 5 Jahren bei 100 % für die anterior axial gesetzten Implantate und bei 98,4 % für die posterior anguliert gesetzten Implantate. Die Leitlinie empfiehlt seit dem letzten Update zwar die festsitzende Versorgung von nur vier Implantaten im zahnlosen Oberkiefer, betont jedoch, dass es sich um ein techniksensitives Verfahren handelt, welches eine umfassende Aufklärung, Planung und eine streng ausgewählte Patientenklientel voraussetzt. Den Vorteilen einer relativ minimalinvasiven, zeitsparenden und kostengünstigen Therapieform, die sich in einer hohen Patientenzufriedenheit und -akzeptanz niederschlägt, stehen die Nachteile einer Extraktion potenziell erhaltungswürdiger Zähne sowie einer eventuell notwendigen vertikalen Knochenreduktion gegenüber.
Schlagwörter: Implantat, zahnloser Oberkiefer, Sofortversorgung, Sofortbelastung, festsitzende Suprakonstruktion, All-on-4
Seiten: 271-284, Sprache: DeutschWolfart, StefanBei einer Parodontitis im Stadium IV kann es trotz aller Therapiemaßnahmen notwendig sein, die noch vorhandenen Restzähne zu entfernen. In dieser Situation ergibt sich ein breiter Therapiekorridor für die implantatverankerte Versorgung des zahnlosen Kiefers. Unterschiedliche Leitlinien empfehlen sowohl festsitzenden als auch herausnehmbaren implantatgetragenen Zahnersatz. Die Frage des genauen prothetischen Designs bleibt jedoch offen. Die individuell beste Therapieoption ergibt sich aus einer Kombination allgemeinmedizinischer und anatomischer Faktoren sowie den Wünschen und Möglichkeiten des Patienten (Patientenprofil). Bei herausnehmbaren Versorgungen sind sowohl die Anzahl der unterstützenden Implantate als auch die Art des Verankerungselements von Bedeutung. Es gibt kugelkopf-, steg- und teleskopverankerte Deckprothesen. Festsitzende kieferüberspannende Restaurationen können entweder zementiert oder verschraubt werden. Es wird empfohlen, verschraubte Verankerungsformen zu wählen, um eine vorhersagbare Abnehmbarkeit zu gewährleisten. Neben den klassischen okklusalen Verschraubungen sind Verschraubungen über Zwischenabutments (Multiunitabutments) und angulierte Schraubensysteme möglich.
Schlagwörter: zahnloser Kiefer, Attachment, Locator, Kugelkopf, Steg, Full-Arch-Restauration, zementiert, verschraubt, angulierte Verschraubung, Multiunitabutments, Patientenprofil, Patientenaufklärung
Seiten: 287-300, Sprache: DeutschEwers, Rolf / Marincola, Mauro / Perpetuini, Paolo / Bonfante, Estevam A. / Cheng, Yu-Chi / Lauer, Günter / Truppe, Michael / Morgan, Vincent J.Im vorliegenden Beitrag soll erörtert werden, inwieweit die Zahl extrakurzer Implantate im atrophen Ober- und Unterkiefer reduziert werden kann und wie die entsprechenden Langzeit-Überlebensraten der Implantate und Prothesen sind. Dazu wurden 152 Patienten im Alter von 50–90 Jahren mit ausgeprägten Atrophien beider Kiefer mit einem, drei oder vier extrakurzen Implantaten (Integra-CPTM, Fa. Bicon, Boston, USA) versorgt. Insgesamt wurden 512 Implantate inseriert. Alle Patienten erhielten eine CAD/CAM-produzierte metallfreie faserverstärkte 10- bis 14-gliedrige implantatgetragene Kunststoffprothese. In der „All-on-four“-Gruppe wurden 18 Patienten (im Durchschnitt 61,22 Jahre alt) mit ausgeprägten Unterkieferatrophien mit 72 Implantaten versorgt und im Durchschnitt 55,4 Monate nachverfolgt. Die Implantat-Überlebensrate betrug 97,2 %. In der „All-on-three”-Gruppe wurden 45 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 71,05 Jahren mit 138 Implantaten (25 Patienten im Unterkiefer, 20 im Oberkiefer) versorgt und bis zu 10 Jahren nachverfolgt. Die Gesamtüberlebensrate der Implantate lag bei 96,5 % und der Prothesen bei 97,8 %. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass extrakurze selbsthemmende Implantate für die Langzeitversorgung atropher Ober- und Unterkiefer geeignet sind und die Zahl der Implantate abhängig von der Atrophie der Kiefer bis auf ein Implantat reduzieren werden kann.
Schlagwörter: extra kurze selbsthemmende Implantate, atrophe Maxilla, atrophe Mandibula, Reduktion der Implantatzahl, CAD/CAM-produzierte metallfreie faserverstärkte Kunststoffprothese
Seiten: 303-320, Sprache: DeutschParvini, Puria / Kallab, Sandra / Obreja, Karina / Peter, Thorsten / Trimpou, Georgia / Schwarz, FrankEin FallberichtDie Mundgesundheit der Menschen hat sich dank Fortschritten in der zahnärztlichen Rehabilitation weltweit verbessert, dies spiegelt sich in der Anzahl an zahnlosen Senioren wider. Für den zahnlosen Kiefer stehen verschiedene Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Implantatgestützter Zahnersatz bietet eine effektive Lösung und führt zu einer verbesserten Lebensqualität der Patienten. Anatomische Herausforderungen und die Qualität des Alveolarknochens beeinflussen den Erfolg dieser Behandlungsoptionen jedoch erheblich. Eine präzise Planung und enge Zusammenarbeit zwischen Behandler, Zahntechniker und Patienten, unter Berücksichtigung der genannten Faktoren, sind für den langfristigen Erfolg der zahnärztlichen Rehabilitation von zahnlosen oder teilbezahnten Patienten essenziell. Im Folgenden soll ein Fallbeispiel einer zahnlosen Patientin ausführlich dargestellt werden.
Schlagwörter: zahnloser Kiefer, anatomische Strukturen, Implantatanzahl, Knochenaugmentation
Seiten: 323-335, Sprache: DeutschMaischberger, Christian / Luft, Vitkor / Wachtel, Hannes / Bechstein, IsabellaEin FallberichtIn der modernen Zahnmedizin haben sich die Ansprüche der Patienten dahingehend entwickelt, dass nicht nur Funktionalität und beschwerdefreies Kauen, sondern auch Ästhetik und Behandlungseffizienz im Vordergrund stehen. Trotz Fortschritten in der präventiven Zahnmedizin, die dazu führen, dass immer mehr ältere Menschen ihre natürlichen Zähne behalten, bleibt die Prävalenz der Zahnlosigkeit aufgrund von Parodontitis signifikant. Das von Paulo Malò entwickelte „All-on-Implants“-Konzept geht auf diese vielfältigen Patientenbedürfnisse ein, indem es festsitzende implantatgetragene Prothesen bietet. Diese Methode zeichnet sich dadurch aus, dass sie selbst bei schwerer Knochenatrophie eine sofortige Belastung der Prothesen auf vier oder mehr Implantaten ermöglicht und somit die Lebensqualität der Patienten erheblich verbessert. Im folgenden Artikel werden verschiedene Herangehensweisen dargestellt, die Bedeutung patientenspezifischer Überlegungen bei der Behandlungsplanung betont und Verbesserungen der Lebensqualität durch festsitzende implantatgetragene Prothesen hervorgehoben. Es wird ein kritischer Vergleich zwischen teilweise analogen und vollständig digitalen Workflows für die Behandlungsplanung präsentiert, wobei die Vor- und Nachteile beider Methoden untersucht und diskutiert werden. Die Integration digitaler Lösungen, wie von 3-D-navigierten Bohrschablonen für die Implantation, Scans als Abformalternativen sowie „Multifunctional Guides“ für sofortige provisorische Prothesen, zeigt erhebliche Zeiteinsparungen und erhöhten Patientenkomfort. Dennoch werden die Präzision und Zuverlässigkeit digitaler Workflows im Vergleich zu traditionellen analogen Methoden, insbesondere in komplexen Fällen, kritisch hinterfragt. Der folgende Artikel zielt darauf ab, Einblicke in die Optimierung von Behandlungsstrategien zu bieten, die digitale Fortschritte mit bewährten analogen Techniken kombinieren, um die bestmöglichen Patientenergebnisse im „All-on-Implants“-Ansatz zu erzielen.
Schlagwörter: Implantologie, zahnloser Kiefer, Sofortbelastung, festsitzender implantatgetragener Zahnersatz, „All-on-Implants“, digitaler Workflow, analoger Workflow
Seiten: 337-342, Sprache: DeutschFonseca, Manrique / Molinero-Mourelle, Pedro / Dönmez, Mustafa Borga / Janner, Simone Francesco / Yilmaz, BurakDas Vorgehen im FallberichtDie provisorische Versorgung unbezahnter Patienten ist ein entscheidender Schritt in der Implantatprothetik. Allerdings kann der Einsatz einer Interimsprothese Probleme bereiten, wenn bei Patienten mit reduziertem Knochenangebot Augmentationsmaßnahmen erforderlich sind. Der vorliegende Fallbericht zeigt die Rehabilitation eines zahnlosen Patienten, der während der Heilungsphase einer vertikalen und horizontalen Kammaugmentation im Oberkiefer mit einer auf kurzen Implantaten verankerten Deckprothese versorgt wurde. Dank dieser Verankerung konnte eine adäquate Stabilität der Interimsprothese erreicht werden, obwohl deren Ränder stark gekürzt wurden, um Druck von den operierten Stellen fernzuhalten. Eine Anwendung der Technik ist ebenso für Fälle denkbar, in denen aufgrund ungenügender Primärstabilität der definitiven Implantate keine Sofortbelastung möglich ist. Originalpublikation: Fonseca M, Molinero-Mourelle P, Donmez MB, Janner SF, Yilmaz B. Interim rehabilitation of an edentulous situation with an overdenture retained by short implants during a staged vertical and horizontal ridge augmentation: a dental technique. Quintessence Int 2023;54:296–300.
Schlagwörter: horizontale Augmentation, Interimsversorgung, Deckprothese, kurze Implantate, vertikale Augmentation
Seiten: 343-350, Sprache: DeutschMarschner, Felix / Duelli, MarcEin Literaturüberblick für die PraxisPeriimplantäre Erkrankungen stellen eine zunehmende Herausforderung im klinischen Alltag dar. Dieser Artikel erläutert ihre mögliche Verbindung mit dem Metabolischen Syndrom. Das Metabolische Syndrom, gekennzeichnet durch Adipositas, Bluthochdruck, erhöhten Blutzucker, erhöhte Triglyceridwerte und niedriges HDL-Cholesterin, erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus. Studien legen nahe, dass Diabetes mellitus und Adipositas das Risiko für Periimplantitis erhöhen, wahrscheinlich durch Veränderungen im Mikrobiom und Entzündungsprozesse. Die Auswirkungen des Metabolischen Syndroms auf die Behandlung von Periimplantitis sind noch unklar, da nicht genügend Studien vorliegen. Es bedarf weiterer Forschung, um diese Zusammenhänge zu klären, sodass in der Praxis systemische Risikofaktoren bei der Implantattherapie berücksichtigt werden können. In diesem Diskussionsbeitrag werden ein Überblick über die aktuelle Studienlage gegeben, wichtige Studien präsentiert und kritisch evaluiert sowie die Relevanz des Metabolischen Syndroms für die Praxis aufgezeigt.
Schlagwörter: periimplantäre Erkrankungen, Periimplantitis, periimplantäre Mukositis, Metabolisches Syndrom, Hyperglykämie
Seiten: 351-359, Sprache: DeutschWolfart, StefanZusammenfassungen wichtiger implantologischer Artikel aus internationalen Zeitschriften